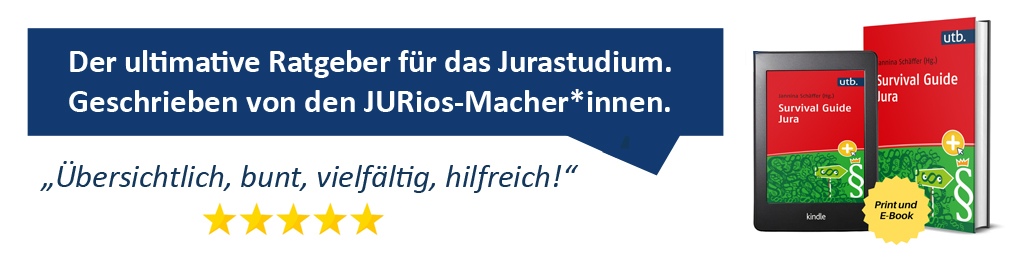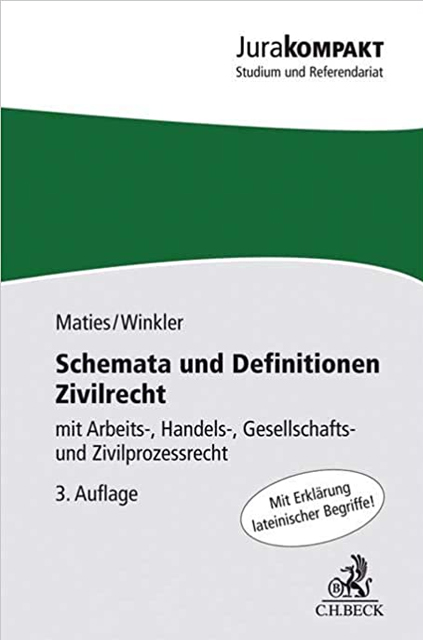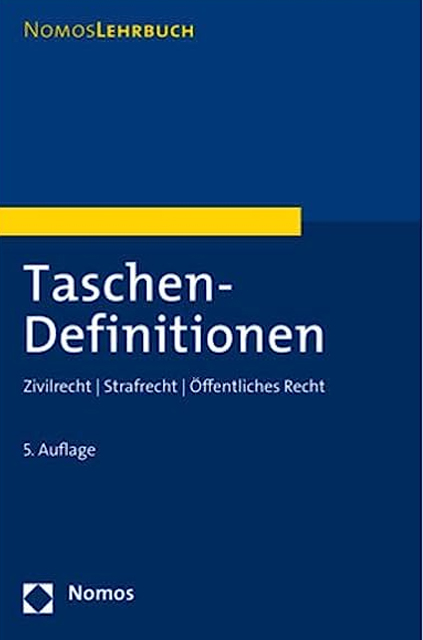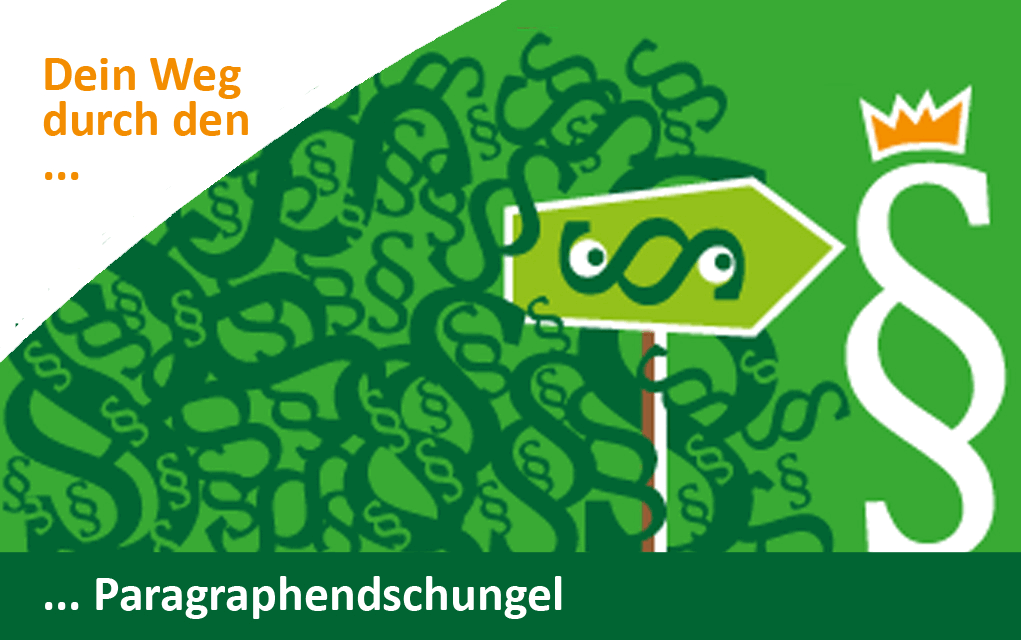Unsere Autorin hat ein Hirn wie ein Sieb und ist ehrlicher als jeder Professor, Repetitor oder Freund es Euch gegenüber jemals sein wird. Trotzdem hat sie es geschafft, das erste und zweite juristische Staatsexamen mit absolut akzeptablen Noten zu bestehen. Seitdem juckt es sie in den Fingern, ihre ultimativen Lerntipps mit Euch zu teilen. Die erste Weisheit lautet: Ein Prädikatsexamen bekommt man nicht, indem man stur alles auswendig lernt. Ohne zumindest die wichtigsten Definitionen zu kennen, geht es aber auch nicht!
Die 24 jeweils wichtigsten Definitionen hat unsere Autorin für Euch in drei Artikeln zum Strafrecht, Zivilrecht und öffentlichen Recht gesammelt. Im Folgenden sollen die wichtigsten Definitionen aus dem Zivilrecht vorgestellt werden. Dabei gibt es gegenüber den anderen Rechtsgebieten jedoch ein paar Besonderheiten.
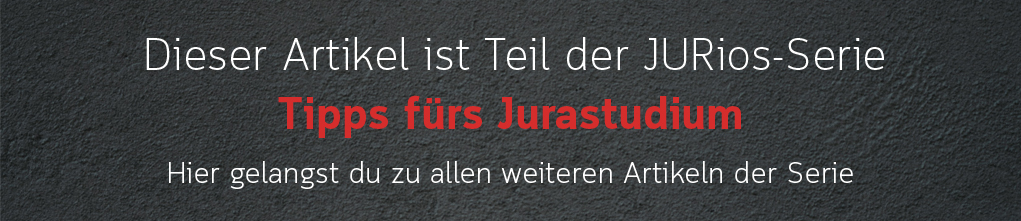
Besonderheiten im Zivilrecht
Im Gegensatz zum Strafrecht muss man im Zivilrecht deutlich weniger auswendiglernen! Das ist gut für diejenigen, die wie unsere Autorin ein unglaublich schlechtes Gedächtnis haben. Allerdings kommt es im Zivilrecht dafür umso mehr darauf an, den Sinn und Zweck der Normen zu verstehen. Die Systematik des BGB, also das Zusammenspiel von AT, BT und Bereicherungsrecht, GoA, EBV und Deliktsrecht muss sitzen! Ansonsten ist man im Zivilrecht spätestens im großen Schein verloren. Denn in keinem anderen Rechtsgebiet ist es so einfach, die komplett falschen Normen zu prüfen, weil man einen Teilaspekt des Falles nicht verstanden oder überlesen hat.
Das BGB hat dafür aber eine andere angenehme Überraschung parat: Es gibt relativ viele Legaldefinitionen. Also Fachbegriffe, die direkt im Gesetz definiert werden. Was bedeutet das für euch? Ihr lernt diese Begriffe natürlich NICHT auswendig, sondern markiert euch nur die entsprechende Stelle im Gesetz. Voila! Eine Liste mit den wichtigsten Legaldefinitionen findet Ihr hier: http://juraeinmaleins.de/legaldefinitionen/
Ansonsten gilt das für Strafrecht gesagte: Die Anforderungen an eine gelungene Klausur ändern sich mit der Zeit. Während am Anfang des Studiums noch jeder Begriff sauber definiert werden sollte, genügt es im Examen bei offensichtlichen Dinge, diese kurz abzuhandeln. Während der Zugang einer Willenserklärung im ersten Semester noch das non plus ultra ist, kann man später oft lapidar feststellen, dass zwischen den Parteien ein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist. Auch im Zivilrecht kommt es also entscheidend darauf an, den richtigen Schwerpunkt zu setzen.
Unsere (faule) Autorin hat von den untenstehenden Definitionen übrigens nur die der Annahme, der Aufwendung, des Erfüllungsgehilfen, der Leistung, des Schadens, der Verwendung und die des Zugangs einer Willenserklärung gelernt. Geschadet hat es ihr nicht!
Die 24 wichtigsten Definitionen
1: Abgabe einer Willenserklärung
Eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung ist abgegeben, wenn der Erklärende seinen Willen erkennbar endgültig geäußert hat. Eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist abgegeben, wenn der Erklärende seinen Willen in Richtung auf den Empfänger geäußert hat.
2: Abhandenkommen
Abhandenkommen i.S.d. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB ist der unfreiwillige Besitzverlust des unmittelbaren Besitzers.
3: Angebot/Antrag
Ein Angebot ist eine auf den Abschluss eines Vertrages gerichtete Willenserklärung, die den Inhalt des Vertrages so weit konkretisiert, dass der Empfänger durch bloße Zustimmung (Annahme) den Vertrag zustande bringen kann.
Eine „invitatio ad offerendum“ stellt mangels Rechtsbindungswillens kein Angebot dar. Denkbar ist ein Angebot an einen unbestimmten Personenkreis („ad incertas personas“).
4: Annahme
Annahme ist das vorbehaltlose Einverständnis mit dem Angebot. Angebot und Annahme sind jeweils einseitige, empfangsbedüftige Willenserklärungen.
5: Anwartschaftsrecht
Ein Anwartschaftsrecht liegt vor, wenn von einem mehraktigen Entstehungstatbestand eines Rechts schon so viele Erfordernisse erfüllt sind, dass von einer gesicherten Rechtsposition des Erwerbers gesprochen werden kann, die der Veräußerer nicht mehr durch eine einseitige Erklärung zu zerstören vermag.
Das Anwartschaftsrecht ist ein sog. „wesensgleiches Minus“ gegenüber dem Vollrecht.
6: Aufwendung
Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer.
7: Erfüllungsgehilfe
Erfüllungsgehilfen i.S.d. § 278 BGB sind die Personen, die mit Wissen und Wollen des Schuldners bei der Erfüllung einer dem Schuldner obliegenden Verbindlichkeit tätig werden.
8: Invitatio ad offerendum
Eine „invitatio ad offerendum“ ist die Aufforderung zur Angebotsabgabe. Es fehlt der Rechtsbindungswille. Der Erklärende will sich noch nicht binden, sondern frei über die Annahme und Ablehnung des Angebots des Vertragspartners entscheiden können.
9: Leistung
Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens.
10: Realakt
Ein Realakt ist eine tatsächliche Willensbetätigung, die kraft Gesetzes eine bestimmte Rechtsfolge herbeiführt. Die Vorschriften für Rechtsgeschäfte sind auf Realakte nicht anwendbar, auch nicht analog.
11: Rechtsbindungswille
Rechtsbindungswille ist die Äußerung eines Rechtsfolgewillens.
12: Rechtsfähigkeit
Fähigkeit, Träger von Rechter und Pflichten zu sein. Die Rechtsfähigkeit eines Menschen beginnt mit Vollendung der Geburt, vgl. § 1 BGB, und endet mit dem Hirntod.
13: Rechtsgeschäft
Das Rechtsgeschäft ist ein Tatbestand, der aus einer oder mehreren Willenserklärungen sowie ggf. aus anderen Elementen besteht und auf den Eintritt einer Rechtsfolge gerichtet ist.
14: Rechtsgeschäftsähnliche Handlung
Eine rechtsgeschäftsähnliche Handlung ist eine auf einen tatsächlichen Erfolg gerichtete Erklärung, die kraft Gesetzes eine bestimmte Rechtsfolge herbeiführt.
15: Schaden
Schaden ist eine unfreiwillige Einbuße.
16: Übergabe
Übergabe i. S. d. § 929 S. 1 BGB setzt eine vollständige Besitzaufgabe des Veräußerers und den Besitzerwerb auf Erwerberseite auf Veranlassung des Veräußerers voraus.
17: Verfügung
Verfügung ist ein Rechtsgeschäft, das unmittelbar auf ein bestehendes Recht einwirkt, sei es durch Übertragung, Aufhebung, Inhaltsänderung oder Belastung.
18: Verkehrswesentliche Eigenschaften
Alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die infolge ihrer Beschaffenheit auf Dauer für die Brauchbarkeit und den Wert der Sache von Einfluss sind.
19: Verrichtungsgehilfe
Verrichtungsgehilfe ist derjenige, dem vom Geschäftsherrn in dessen Interesse eine Tätigkeit übertragen wurde und der von den Weisungen des Geschäftsherrn abhängig ist.
20: Verschulden
Verschulden nach § 276 Abs. 1 HS. 1 BGB meint Vorsatz und Fahrlässigkeit des Schuldners.
21: Verwendung
Verwendungen sind Vermögensaufwendungen, die der Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung einer Sache dienen.
22: Willenserklärung
Eine Willenserklärung ist eine private Willensäußerung, die unmittelbar auf den Eintritt einer privatrechtlichen Rechtsfolge gerichtet ist.
23: Zugang einer Willenserklärung
Eine Willenserklärung geht zu, wenn sie derart in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass er unter normalen Verhältnissen von ihrem Inhalt Kenntnis erlangen kann.
24: Zustandekommen eines Vertrags
Ein Vertrag kommt durch zwei überstimmende Willenserklärungen zustande.