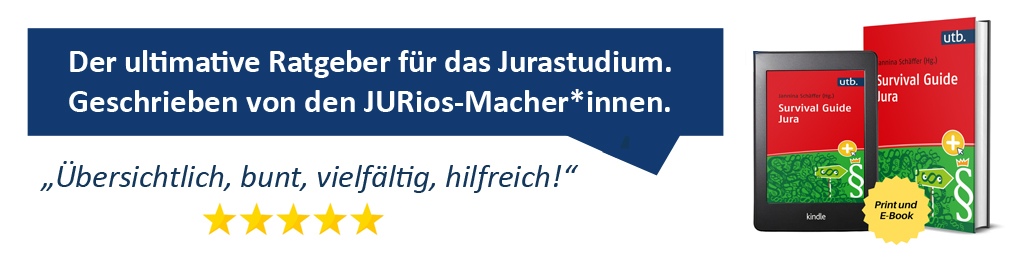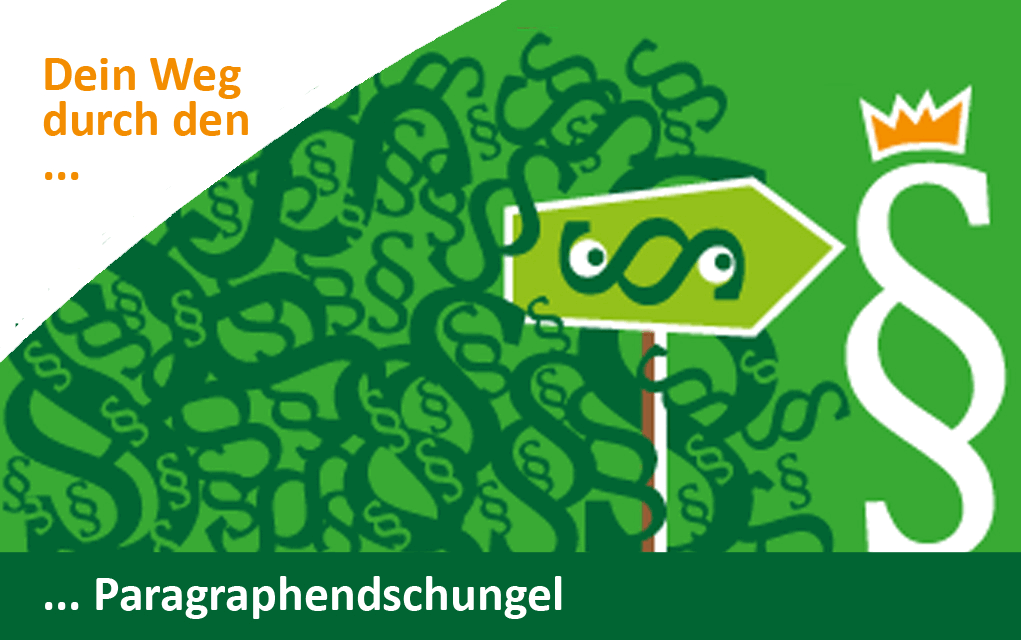Tipps für das erfolgreiche Jurastudium gibt es zur Genüge. Man bekommt sie bereits auf dem Campus – nicht selten ungefragt von den eigenen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und wer es gern schriftlich hat, kann inzwischen auf eine Vielzahl an Skripten und Lehrbüchern zurückgreifen. Mit diesem (Über-)Angebot kann und will der vorliegende Beitrag nicht mithalten. Er hat, wenngleich es auch hier um den Erfolg im Jurastudium geht, ein anderes Ziel, nämlich die Bedeutung von Sprache für die Juristerei zu betonen.
Dazu eine Vorbemerkung: Aus der Sicht des Autors, die – mittlerweile – eine Retrospektive ist, hängt der Erfolg im Jurastudium auch davon ab, wie gut das Sprachgefühl bei den Studentinnen und Studenten ausgeprägt ist. Zugegeben, das ist weder eine bahnbrechend neue noch eine, in dieser Allgemeinheit, besonders hilfreiche Erkenntnis. Dennoch sollte man sich ihr nicht verschließen. Denn das Sprachgefühl bildet die Grundlage dafür zu erkennen, worauf es bei juristischen Fragestellungen ankommt.
Sprachgefühl als Grundlage der juristischen Arbeit
Hat man erst einmal verstanden (und für sich akzeptiert), dass den Juristinnen und Juristen die Sprache als Werkzeug dient, ist der nächste Erkenntnisschritt nicht schwer: Juristensprache will gelernt sein. Damit ist freilich nicht gemeint, dass man fortan nur noch schwer verständliche, an der Grenze zur „Schwurbeligkeit“ liegende Sätze zu Papier bringt oder – was gerade zu Anfang leicht passiert – mit lateinischen Begriffen versucht zu beeindrucken. Nein, Juristensprache war und ist weitaus mehr als ein Erkennungssymbol für Eingeweihte oder eine kompliziertere Form von Alltagssprache. Sie ist eine Zwecksprache, mit der man ausdrückt, was Recht und Gesetz ist. Und da Recht und Gesetz, wie es in Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz heißt, für die Rechtsprechung und die vollziehende Gewalt bindend sind, hat sich im Laufe der Zeit nicht nur ein typischer Wortschatz, sondern auch eine besondere Systematik herausgebildet, wonach viele Begriffe keine alltägliche Bedeutung, sondern eine spezifische fachliche Bedeutung haben. Um dies zu veranschaulichen, folgen nun zwei kleine Beispiele:
Ermessensvorschriften
Erstes Beispiel: Ermessensvorschriften. Gerade im Verwaltungsrecht sind sie nicht wegzudenken. Dabei werden die unterschiedlichen Arten des behördlichen Ermessens im Gesetz dadurch zum Ausdruck gebracht, dass der Gesetzgeber sogenannte Muss-, Soll- oder Kann-Vorschriften formuliert hat. Während eine Muss-Vorschrift dem Normadressaten eine Rechtsfolge zwingend vorgibt, eröffnen Soll- und Kann-Vorschriften dem Entscheidungsträger – freilich in unterschiedlicher Form – einen Ermessenspielraum: Bei einer Soll-Vorschrift besteht ein Regel-Ausnahme-Verhältnis dahingehend, dass von der Regelfolge nur in besonderen, atypischen Ausnahmefällen abgewichen werden darf. Anders ist es im Falle einer Kann-Vorschrift. Hier besteht für die Behörde ein weiter – gerne als offen bezeichneter – Ermessenspielraum.
Vorsatzformen
Zweites Beispiel: Vorsatzformen. Es gibt – nach ganz überwiegender Auffassung in Rechtsprechung und Rechtslehre – drei Vorsatzformen im Strafrecht: den dolus directus 1. Grades, dolus directus 2. Grades und den dolus eventualis. Für die Klausur – wie auch für die Gerichtspraxis – ist mit der Feststellung der Vorsatzform jedoch noch nichts Konkretes dazu gesagt (geschweige denn begründet), aus welcher Tatmotivation heraus der Täter oder die Täterin gehandelt hat. Will sagen: Es genügt weder in der Klausur noch in der gerichtlichen Praxis schlicht zu behaupten, diese oder jene Vorsatzform liege vor. Man muss den Leser oder die Leserin, sei es ein Prüfer oder die Rechtsmittelinstanz, vielmehr anhand des Sachverhalts davon überzeugen, welche Tatmotivation bestand. Dazu gehört es insbesondere, die Vorsatzformen statt in abstrakte, lateinische Begriffe in konkrete Worte zu fassen. Tut man dies, so wird aus dolus directus 1. Grades der unbedingte Wille des Täters oder der Täterin, den Taterfolg herbeizuführen, aus dolus directus 2. Grades wird das sichere Wissen von den Folgen des eigenen Handelns und der dolus eventualis lässt sich als ein Für-möglich-Halten bei gleichzeitiger billigender Inkaufnahme des Taterfolgs beschreiben.
Diese Beispiele zeigen bereits, was es bedeutet, Juristensprache zu verwenden. Wer sie verinnerlichen und ein Gefühl für ihre Besonderheiten entwickeln will, kann neben entsprechender Ausbildungsliteratur, wobei das Buch von Frau Prof´in Puppe „Kleine Schule des juristischen Denkens“ (Amazon Affiliate Link) sehr zu empfehlen ist, auch auf Gerichtsentscheidungen als Lektüre zurückgreifen. Hier gilt, wie so oft, der Merksatz: Früh übt sich!
Mit der juristischen Sprache beschäftigt sich auch Prof. Dr. Roland Schimmel in seinem Gastartikel „Am Ende sind Sie ein anderer Mensch – wie das Jurastudium unsere Sprache beeinflusst”.