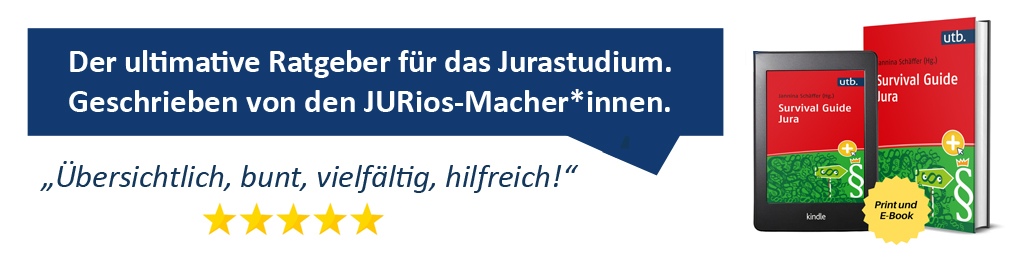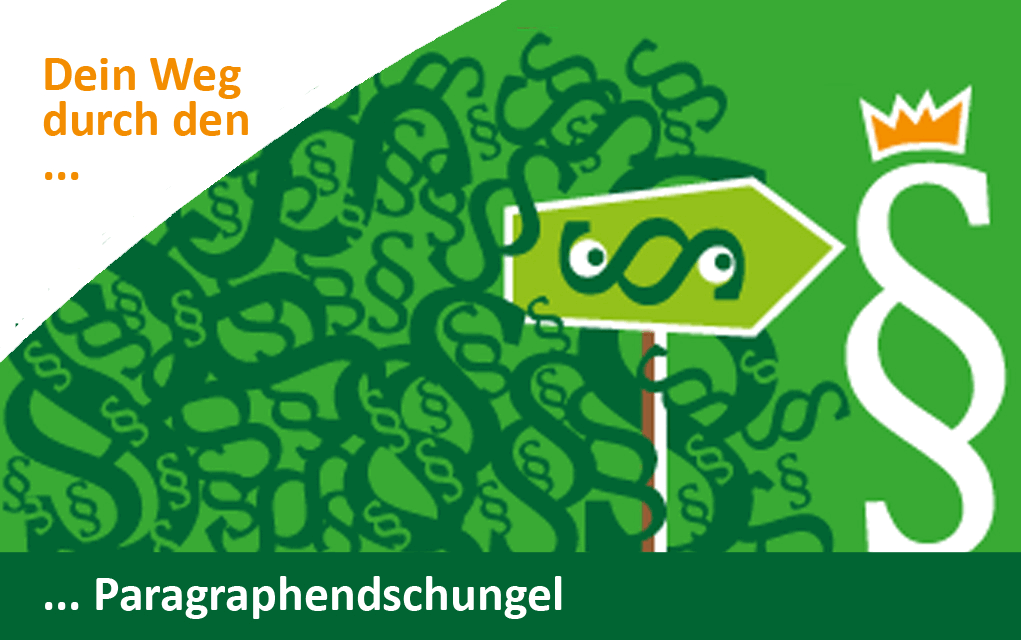Vorsatz im Strafrecht – das ist eigentlich eine klare Sache. Schon im ersten Semester werden Studentinnen und Studenten mit Vorsatzfragen im Strafrecht konfrontiert. Und man präsentiert ihnen die gängigen Vorsatzdefinitionen, die einem – der Autor kann es bezeugen – von da an meist lebenslänglich im Kopf bleiben.
Man lernt: Beim Vorsatz im Strafrecht geht es um das „Wissen und Wollen“ der Tatbestandsverwirklichung, wobei zwischen drei Vorsatzformen unterschieden wird: dem dolus eventualis sowie dem dolus directus 1. und 2. Grades. Zugegeben: Das klingt – dem Latein sei Dank – nicht nur gut, sondern wird auch zu Recht als herrschende Ansicht in Rechtsprechung und Rechtslehre ausgegeben. Verständlich also, dass sich Studentinnen und Studenten schon früh in Sicherheit wähnen, wenn es um die Frage geht, was Vorsatz ausmacht.
Vom Definitionsmangel…
So klar, wie es scheint, ist die Sache allerdings nicht – zumindest dann nicht, wenn man ins Gesetz schaut. Bei einer Durchsicht des StGB stellt sich schnell Ernüchterung ein. Zwar findet man, gerade im prominenten Bereich der Kapitaldelikte, jede Menge tatbestandliche Vorsatzerfordernisse. Und § 15 StGB unterstreicht mit dem dort enthaltenen Postulat, dass ein Verhalten grundsätzlich nur dann strafbar ist, wenn der Täter oder die Täterin vorsätzlich gehandelt hat, noch einmal die besondere Bedeutung von Vorsatz im Strafrecht.
Was man allerdings vergeblich sucht, ist eine allgemeine Vorsatzdefinition. Dies gilt auch mit Blick auf § 16 Abs. 1 S. 1 StGB. Dort erfährt man lediglich, wann ein Mensch nicht vorsätzlich handelt, nämlich immer dann, wenn er „bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört“. So weit, so ernüchternd.
…über den Konflikt mit dem Bestimmtheitsgebot…
Dass das Strafgesetz nicht in jedem Fall eine Legaldefinition bereithält, ist keineswegs ungewöhnlich. Das Fehlen einer allgemeinen Vorsatzdefinition kann jedoch zum Problem werden, vor allem dann, wenn es um das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot aus Art. 103 Abs. 2 GG geht. Denn vor dem Hintergrund der von Gesetzen zu gewährleistenden Rechtssicherheit muss im sensiblen, weil sanktionsbewehrten Bereich des Strafrechts für den Normadressaten jederzeit erkennbar sein, welche Rahmenbedingungen für sein Verhalten gelten. So betrachtet erscheint es durchaus problematisch, dass der Gesetzgeber es unterlassen und stattdessen Rechtsprechung und Rechtslehre überantwortet hat, den Vorsatz im Strafrecht zu definieren. Dies gilt umso mehr, als es auf eine Abgrenzung zwischen (Eventual-)Vorsatz und (bewusster) Fahrlässigkeit, die ebenso wenig legaldefiniert ist, ankommt.
…zum praktischen Problem…
Nun könnte man meinen, dass dieses Problem praktisch wenig relevant ist, zumal es eine gefestigte Rechtsprechung gibt. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Hier der Beweis: In seiner aktuellen Entscheidung zum sogenannten Kudamm-Raser-Fall (BVerfG, Beschl. v. 07.12.2022Az. 2 BvR 1404/20 = BeckRS 2022, 36007) hat sich das Bundesverfassungsgericht unter anderem mit der Frage befasst, ob das Tatgericht mit der Annahme, der Beschwerdeführer habe mit Tötungsvorsatz gehandelt, die Vorgaben des Art. 103 Abs. 2 GG missachtet hat.
Der Beschwerdeführer hatte im Rahmen seiner Verfassungsbeschwerde nämlich Folgendes (Rn. 29) gerügt:
„Die von den Gerichten vorgenommene normative Vorsatzbestimmung führe weiter dazu, dass derjenige, der vorsätzlich nur eine abstrakte Gefahr heraufbeschwöre, zwar sicher nach §§ 211, 212 StGB, unter Umständen aber nicht nach § 315c StGB verurteilt werden könne. Das belegten insbesondere die angegriffenen Entscheidungen, denn Landgericht und Bundesgerichtshof hätten hier den Vorsatz auf eine Zeit vorverlagert, zu der ein potentieller Unfallgegner noch nicht sinnlich wahrnehmbar gewesen sei. Damit seien sie von einer abstrakten Gefahr direkt zum Gefahrenerfolg übergangen, ohne dass es zuvor eine konkrete Gefahr gegeben hätte, während deren Eintritts der Fahrer noch handlungsfähig gewesen wäre. Diese Rechtsprechung missachte das aus Art. 103 Abs. 2 GG abgeleitete Gebot, verbleibende Unklarheiten über den Anwendungsbereich einer Norm durch Präzisierung und Konkretisierung im Wege der Auslegung nach Möglichkeit auszuräumen.“
Dem ist das Bundesverfassungsgericht (Rn. 41) unter anderem mit folgenden Worten entgegengetreten:
„Die Rüge, die Fachgerichte hätten eine dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG widersprechende Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit vorgenommen, dringt nicht durch. Unschädlich ist, dass das Strafgesetzbuch die Begriffe des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit zwar verwendet, aber keine die Rechtsanwendung anleitenden Definitionen für diese beiden Begriffe enthält. Auch vor dem Hintergrund des Bestimmtheitsgrundsatzes aus Art. 103 Abs. 2 GG ist es verfassungsrechtlich nicht geboten, im Gesetz Definitionen für diese beiden Begriffe, insbesondere für die Rechtsfiguren des bedingten Vorsatzes und der bewussten Fahrlässigkeit, vorzusehen.“
All das zeigt: Der Vorsatz im Strafrecht ist ein spannendes Thema. Auch und gerade, weil die bereits aus dem Grundstudium bekannten Definitionen nicht vom Gesetzgeber stammen.