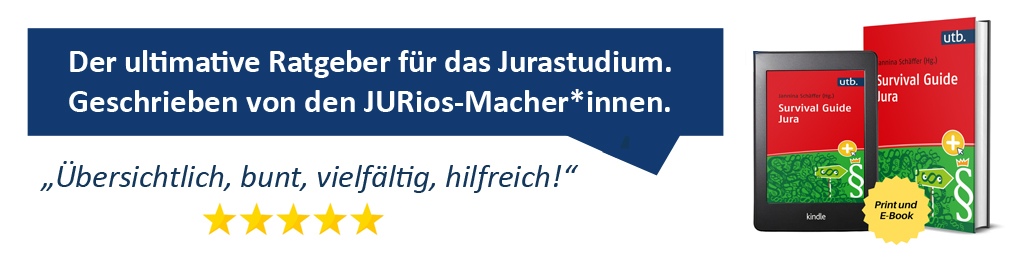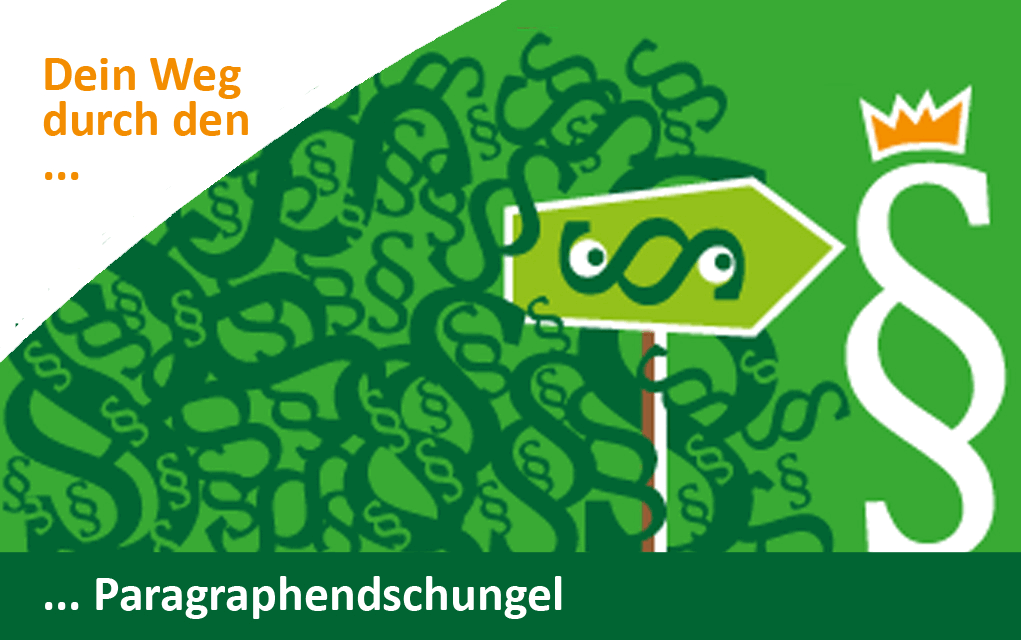Nach einem fünfjährigen Studium müssen angehende Volljurist:innen zwei Jahre praktische Erfahrungen im Rechtsreferendariat sammeln, bevor sie das zweite Staatsexamen ablegen dürfen. Doch das deutsche Rechtsreferendariat ist eine Farce aus Kindergarten und Bevormundung bei gleichzeitig voller Verantwortung für das eigene Handeln. Kann das gut gehen?
Im Rechtsreferendariat durchwandern angehende Volljurist:innen zwei Jahre lang verschiedene Stationen, in denen sie jeweils mehrere Monate lang Einblicke in eine bestimmte juristische Tätigkeit erhalten. Klassischerweise beginnt das Referendariat mit der Zivilstation. Daran schließen sich entweder Strafstation oder Anwaltsstation an. Am Ende stehen (je nach Bundesland) die Verwaltungsstation und die Wahlstation an. In der Theorie sollen Jurist:innen so optimal auf die Praxis der gerichtlichen sowie anwaltlichen Tätigkeit vorbereitet werden. In der Realität klappt das leider oft nur mangelhaft.
Die Einführungslehrgänge: Willkommen in der Schule, sitzen, sechs!
Jede Station im Referendariat beginnt mit einem „kurzen“ Einführungslehrgang. Das Problem: Weil Jurastudierende im Jurastudium fast nur materielles Recht gelernt haben, fehlt ihnen komplett das Wissen über die realen Abläufe vor Gericht, in einer Kanzlei oder in der Verwaltung. Von Prozessrecht haben die meisten zu Beginn ihres Referendariats nur am Rande gehört. Grundsätzlich ist es deswegen eine gute Idee, in mehrwöchigen Einführungslehrgängen die absoluten „Basics“ zu lehre.
Doch wie sieht es in der Praxis aus? Die Einführungslehrgänge sind extrem verschult, schlecht organisiert und teilweise mit komplett unfähigen Dozierenden besetzt. In der Zivilstation in Baden-Württemberg muss man beispielsweise einen Monat lang jeden Tag um neun Uhr auf der Matte stehen und sich ganztägig das Zivilprozessrecht beibringen lassen. Zu den Dozierenden gehören hier vor allem Zivilrichter:innen. Diese haben didaktisch leider oft wenig Erfahrung. Das sieht dann so aus: Schlecht vorbereitete „Boomer“ lesen Paragraphen von A4-Blättern ab. Eine Veranschaulichung mittels PowerPoint? Fehlanzeige. Anschauliche Fallbeispiele? Unnötig! Nachfragen? Verboten! Wenn man viel Glück hat, gibt es Tafelaufschriebe und man wird für vermeintlich „dumme“ Fragen nicht angeschrien.
Einige Dozierende krönen diese Erfahrung dann noch mit dem Bloßstellen der neuen Referendar:innen durch Fragen aus der Praxis, von denen man in diesem Stadium noch keine Ahnung hat. Gleichzeitig gängelt einen die Ausbildungsstelle mit Anwesenheitspflicht (wird mit einer Anwesenheitslisten kontrolliert) sowie Urlaubsverboten und übermäßig strengen Regelungen bei Krankheit. Wer bis neun Uhr nicht am Gericht angerufen hat (lustigerweise erreicht man dort meistens niemanden), gilt als unentschuldigt und bekommt einen Eintrag in seine Akte. Hört sich schrecklich an? Ist es auch!
Bürokratie-Wahnsinn auf höchstem Niveau: Die verschwundene Post
Am besten wird man auf die Realität an deutschen Gerichten und in der Verwaltung sicherlich durch den Bürokratie-Wahnsinn vorbereitet, der sich durch das gesamte Rechtsreferendariat zieht. Sieht so der Alltag an Gerichten und in Behörden aus? Dann verzichte ich dankend auf eine Bewerbung! Hier einige Beispiele zur Veranschaulichung:
Anträge konnten (zumindest in meinem Bundesland) damals nur postalisch (ja, als Brief!) eingereicht werden. Anfragen per Mail wurden grundsätzlich nicht bearbeitet und nicht beantwortet. Das galt für die Bewerbung für das Referendariat genauso wie für Krankschreibungen, Urlaubsanträge und die Zuweisung zu den Stationen. Hatte man einen Brief abgesendet, verschwand dieser in einer „Blackbox“ es gab keine Möglichkeit, herauszufinden, ob dieser angekommen war und bearbeitet wurde. So erging es mir z.B. bei meiner Bewerbung. Das Referendariat startet in einigen Bundesländern nur zweimal im Jahr. Wer die Anmeldefrist verpasst, muss also ein halbes Jahr warten. Völlig übermotiviert reichte ich meine Bewerbung deswegen (dreimal gecheckt) postalisch per Einschreiben ein. So konnte ich mir zumindest sicher sein, dass sie ankam. Eine Eingangsbestätigung gab es nicht. Also wartete ich drei Monate lang auf Antwort. Was, wenn ein Antrag falsch ausgefüllt war oder Unterlagen fehlten? Würde ich dann informiert werden? Telefonisch konnte man mir diesbezüglich keine Auskunft geben. Ich solle abwarten. In diesem Fall ging zum Glück alles gut.
In einem anderen Fall leider nicht. Mein postalisch eingereichter Urlaubsantrag ging verloren. Das erfuhr ich allerdings nicht vor meinem Urlaubsantritt, sondern erst danach. Als ich einen bitterbösen Brief erhielt, dass ich eine Woche unentschuldigt gefehlt hatte. Denn der Eingang und die Bewilligung des Urlaubs wird einem von der Ausbildungsstelle nicht bestätigt. Die Anweisung hatte gelautet: Wenn Sie nichts von uns hören, ist ihr Antrag bewilligt (was ist das bitte für eine Regelung?!). In meinem Fall hatte ich mir zwar eine Kopie meines Urlaubsantrags gemacht, diese wurde von der Justiz jedoch nicht akzeptiert. Das könne ja jede:r nachträglich „fälschen“. Vielen Dank für diese Unterstellung.
Ich hatte meine Lektion gelernt und fragte ab jetzt vor jedem Urlaub telefonisch nach, ob dieser genehmigt sei. Meistens dauerte das mehrere Tage. Denn Rückrufbitten wurden grundsätzlich ignoriert. Man musste also „Glück“ haben, die richtige Person zur richtigen Zeit zu erreichen. Soviel ich weiß, stehen die Fehltage aus meinem ersten „Urlaub“ bis heute in meiner „Akte“.
Aber es wird noch interessanter: Den Antrag auf Zulassung zur Anwaltsstation warf ich nicht einfach in einen Briefkasten, sondern gab diesen in die interne Poststelle der Gerichte zur direkten internen Zustellung. Auch hier behauptete die Ausbildungsstelle, man habe den Brief nicht erhalten und verwies lapidar darauf, dass dieser wohl „in der Post verloren gegangen“ sei. Auf meinen Hinweis, dass ich den Antrag nicht per Post verschickt habe: Schweigen. Alle weiteren Anträge reichte ich durch persönliche Übergabe ein. Sicher ist sicher.
Pure Gängelei: Die Geschichte mit dem Stempel
Während man an Gerichte und Behörden „zugeteilt“ wird, darf man sich die Anwaltsstation und die sog. „Wahlstation“ selbst aussuchen. So viel Freiheit? Naja! Auch diese Zulassung erfolgt höchst kompliziert. Es muss – natürlich – ein Formular ausgefüllt werden. Auf diesem muss die Stelle (z.B. Kanzlei) bezeichnet werden und der oder die dortige Ausbilder:in muss das Dokument unterschreiben. Soweit, so logisch.
Prima, dachte ich und reichte meinen Antrag für die Wahlstation bei einem Legal Tech Start-up von meinem Wunschausbilder unterschrieben ein. Doch so nicht! Die Bürokratie schlug sofort zurück! Auf meinem Antrag fehle ein „Stempel“. „Welcher Stempel?“, fragte ich. „Na, der Stempel des Unternehmens oder der Kanzlei“, antwortete die Sekretärin, die mich inzwischen schon persönlich kannte. „Das Start-up hat keinen Stempel“, sagte ich freundlich. „Jedes Unternehmen MUSS einen Stempel haben“, erklärte sie mir. So kamen wir nicht weiter. Ich bat also den vielbeschäftigten Geschäftsführer des Jura-Start-ups, doch bitte bei meiner Ausbildungsstelle anzurufen, um zu bestätigen, dass sein Unternehmen über keinen Stempel verfüge. Wie peinlich! Er kam diesem Anliegen netterweise nach und – nachdem er das Fehlen des Stempels auch noch schriftlich bestätigt hatte – durfte ich meine Wahlstation bei ihm antreten. Geht es noch kafkaesker?
Willkürliche Zeugnisse, Klassendenken und mehr
Doch auch die einzelnen Stationen liefen nicht sonderlich besser. Es gab Stationen, in denen man als billiges Arbeitstier missbraucht wurde, das den Mist erledigen sollte, auf den sonst niemand Lust hat. So beispielsweise bei der Staatsanwaltschaft. Diese setzen in allen Bundesländern Referendar:innen gerne als sog. „Sitzungsvertreter:innen“ ein. Eigentlich eine tolle Möglichkeit, erste Berufserfahrungen zu sammeln, die eigene Rhetorik zu schulen und zu prüfen, ob ein Berufseinstieg bei der Staatsanwaltschaft für einen in Betracht kommt. Eigentlich. In Realität werden Referendar:innen kreuz und quer durch den Gerichtsbezirk geschickt, um Vertretungsfälle zu übernehmen. Meistens erhält man die Akte nur wenige Tage vorher, eine gute Vorbereitung oder Rücksprache mit dem Ausbilder ist nicht möglich.
Man geht also völlig „blind“ in die Verhandlungen und hofft, dass nichts schiefgeht. Gegenüber den Angeklagten finde ich ein derartiges Vorgehen fragwürdig und kaum noch rechtsstaatlich; auch die Strafrichter:innen sind oft „not amused“. Denn die Sitzungsvertreter:innen können kaum sinnvolles zum Verfahren beitragen. Im schlimmsten Fall passieren grobe Fehler, z.B. wenn ein wichtiger Antrag nicht gestellt wird. Doch es wird noch peinlicher. Während man einerseits mehrjährige Haftstrafen (!) verhandeln soll, muss man andererseits für bestimmte Verfahrenshandlungen den oder die Ausbilder:in anrufen und um „Erlaubnis“ bitten. Dafür wird die Verhandlung zum Telefonieren unterbrochen. Fun fact: Meistens erreicht man bei der Staatsanwaltschaft niemanden, sodass sich die Verhandlung extrem verzögert.
Und auch der eine oder die andere Richter:in tickt noch heute wie im Jahre 1950 und sollte eigentlich nicht ausbilden. So begegneten mir sexistische Landrichter, eine rassistische Behördenleiterin, die über “Ausländer” und “Flüchtlinge” herzog und eine elitäre Amtsrichterin. Ihre erste Frage in meiner Zivilstation war, welchem Beruf meine Eltern nachgehen würden. Naiv wie ich war, dachte ich, sie wolle vielleicht herausfinden, ob sie meine Familie kennt, da wir aus der gleichen Stadt stammten. Gegen Ende der Zivilstation wurde mir aber klar, dass es ihr vielmehr um meine „Herkunft“ gegangen war. Dass sie von „Arbeiterkinder“ in der Justiz nichts hielt, bestätigte sich dann auch bei einem Blick auf mein Zeugnis, das unterdurchschnittlich schlecht ausfiel. Eine Begründung dafür habe ich auch auf Nachfrage nicht erhalten – in meinen anderen Stationszeugnissen stehen teils doppelt so viele Punkte….
Mütter, Promotionsstudenten und erfolgreiche Unternehmerinnen
Im Rechtsreferendariat treffen Mütter, Promotionsstudenten und erfolgreiche Unternehmerinnen aufeinander. Sie alle haben es im Leben bereits „zu etwas gebracht“. Haben im persönlichen, akademischen oder beruflichen Bereich viel geleistet. Und trotzdem eint sie alle eines: Im Rechtsreferendariat werden sie wie kleine Kinder behandelt. Als oben genannte Richterin nach meiner Zeugnisübergabe erfuhr, dass ich promoviere, zog sie nur die Augenbraue hoch und meinte „das werde ja bestimmt nichts“ und falls doch, könne ich damit dann ja immerhin meine schlechte Stationsnote ausgleichen, wenn ich der Meinung sei, dass ich „etwas Besseres wäre“. Danke für Nichts. Dabei wollte ich doch einfach nur eine nicht willkürliche Note….
Es ist verständlich, dass sich gerade Referendar:innen um die 30, eventuell mit bereits abgeschlossener Ausbildung oder Zweitstudium, im Referendariat sprichwörtlich „verarscht“ fühlen. Sie werden dort wie kleine, unerzogene Kinder behandelt. Das ist schade, wenn man bedenkt, dass all diese Menschen eine Bereicherung für die Justiz darstellen könnten. Wenn man sie doch nur fair behandelt und angemessen bezahlen würde. Denn das ist noch so ein Punkt: Während unsere Freund:innen bereits Häuser bauen und Babys bekommen, werden wir mit einer “Aufwandsentschädigung” unterhalb des Existenzminimums abgespeist. Selbst in Ausbildungsberufen ohne Studium – beispielsweise im Verwaltungsbereich – verdienen die 18-Jährigen Auszubildenden inzwischen teils gleich viel wie 30-Jährige Referendar:innen mit abgeschlossenem Studium. Das kann und darf nicht sein.
Wer so mit seinem juristischen Nachwuchs umgeht, muss sich nicht wundern, wenn Absolvent:innen entweder überhaupt kein Referendariat ablegen oder danach in möglichst hoch dotierte Jobs in Großkanzleien und Wirtschaft wechseln. Denn wir müssen jetzt das aufholen, was wir in den letzten 5-10 Jahren „Dank” Jura verpasst haben.